Gesehen: A Confucian Confusion (1994) - Walter Benjamin gefällt das
FilmkritikEdward Yang verhandelt radikale Umbrüche nicht nur durch seine Figuren, sondern auch in der Form seines Films.

„Ich mag meine Bücher und die deine Fernsehsendung" – darum dreht sich ein Streit zwischen zwei der Figuren von Edward Yang. Vielleicht lassen sich Menschen wirklich klar in diese beiden, scheinbar unvereinbaren Kategorien einordnen. Vielleicht sind es diese beiden Kategorien, die diesen Moment in Taipeh in dieser Zeit so treffend wie nur wenig andere Bilder beschreiben.
Wirtschaftsboom, Demokratisierung, zunehmende Adoption als westlich wahrgenommener Werte. Tradition trifft auf Moderne, Konservatismus auf freiheitlicheres Denken, vermeintlich bewussteres Leben auf radikalen Konsum im Turbokapitalismus. Edward Yang zeigt unter dem Brennglas eine Stadt, in der bisherige Denkkategorien nicht mehr funktionieren, bisherige Wege plötzlich nicht mehr zum Ziel führen und in der sich der Mensch neu sortieren und einordnen muss.
Das sind Gabelungen, an denen sich besonders beim rasanten Tempo dieser Entwicklungen im Taipeh der 1990er Jahre gefühlt erst mal keine Mittelwege bauen lassen. Es bleibt nur die Hoffnung, dass die aufgegabelten Wege irgendwann wieder zusammenkommen.
Es muss unglaublich kräftezehrend gewesen sein, sich innerhalb dieses brutalen Malstroms des grundlegenden Wandels seiner eigenen Werte und Überzeugungen zu vergewissern, für sie und damit sich selbst einzustehen und dabei auch Familie, Freund*innenschaften und Liebesbeziehungen infragezustellen.
Besonders Edward Yangs Blick auf die Kunst innerhalb dieses Malstroms lässt sich hervorragend im Kontext von Walter Benjamins Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit betrachten. Das Filmschaffen, eine traditionell langsame Ausdrucksform, steht nun plötzlich einem immer billiger und immer schneller produzierbaren Fernsehen gegenüber.
Ich finde, dass Yang besonders dieses Spannungsfeld auch bildästhetisch in seinem Film verhandelt. Denn der schwankt immer wieder zwischen einer zurückhaltenden, intimeren Bildsprache und einer irritierend klaren, digitalen, künstlichen und fast schon billigen Seifenopernoptik. Er lässt die Umwälzungen dieser Zeit also nicht nur von seinen Figuren verhandeln. Yang begibt sich auch durch die immer wieder Widersprüche produzierende Form seines Films in den Konflikt.
★★★★☆
Die Kritik auf Letterboxd:

Die Kritik als Tonspur:
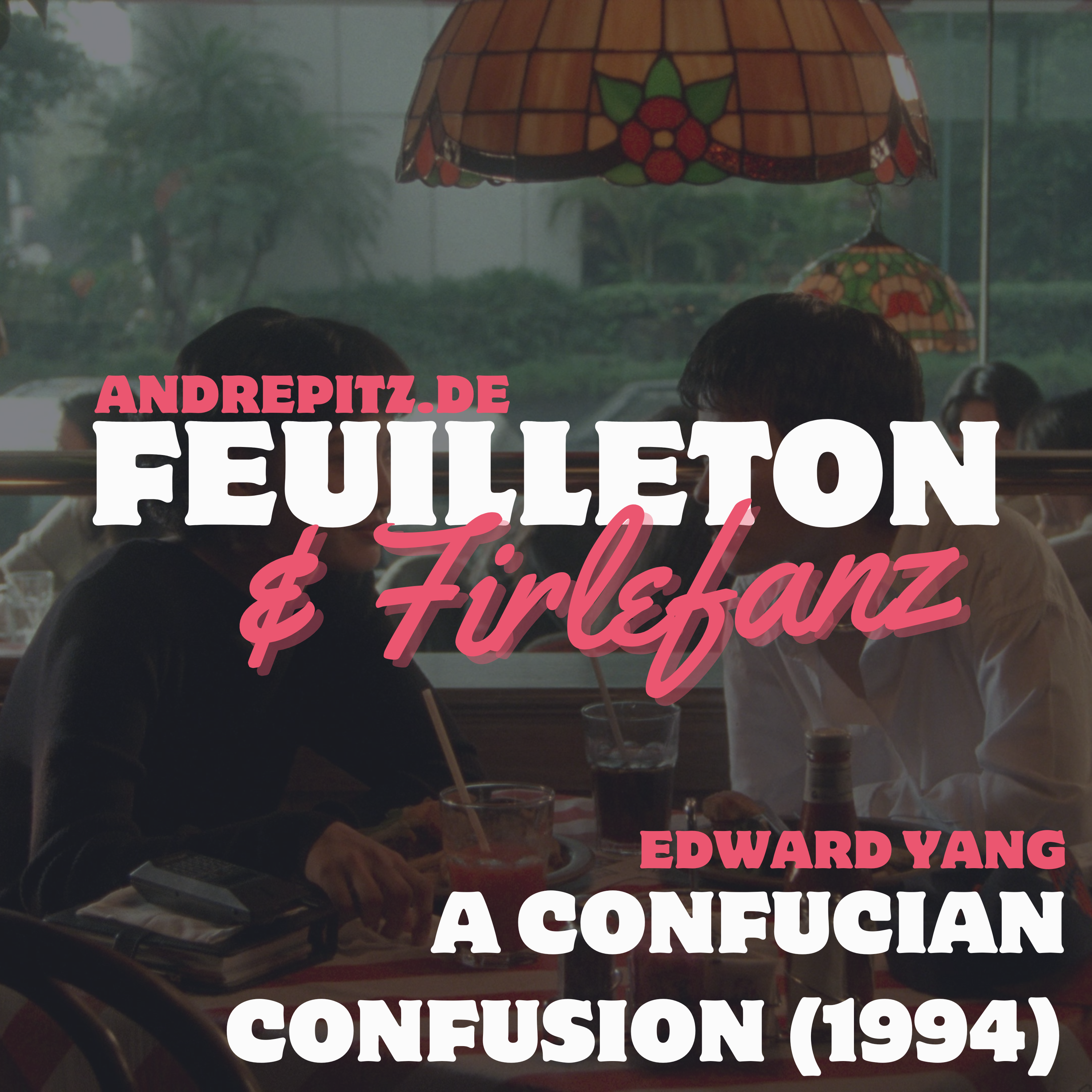
Alle Filmkritiken als Podcast abonnieren: RSS · Apple Podcasts · Spotify





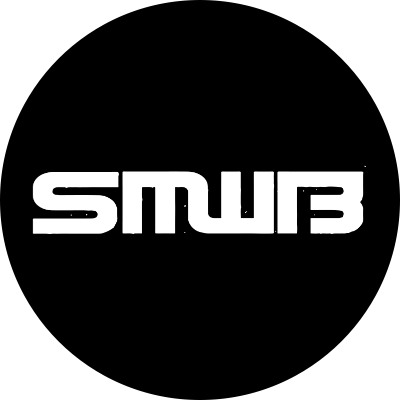

Comments